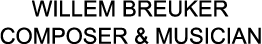Jazz Zeitung 2004-11
Menschenmusik aus Amsterdam
Zum 60. Geburtstag von Willem Breuker
Von Bert Noglik
„Wenn man es kann, dann muss man es tun.“ Willem Breuker, Saxophonist, Klarinettist, Bandleader, Komponist, Arrangeur, Improvisator, hat sich nie geschont, immer verausgabt. Und er scheint nicht gewillt, daran etwas zu verändern. „Als ich am 4. November 1944 in einer Amsterdamer Vorstadt zum ersten Mal schrie,“ sagt er, „war klar, dass ich der Welt, in die ich da hineingeboren wurde, kräftig ins Gesicht blasen würde.“ Und auf die Frage, wie lange er die Straßenkonzerte mit seiner Band, dem „Kollektief“, fortsetzen wolle, antwortete er vor Jahren: „So lange, bis es keinen Marktplatz mehr in Europa gibt, auf dem wir noch nicht gespielt haben.“ Ob große Konzerthallen, Straßen- oder Klubkonzerte, ob mit dem Bus kreuz und quer durch Europa oder mit dem Flieger zu Fernzielen (erst jüngst nach China) – was die Aktivitäten, des Willem Breuker Kollektiefs anbelangt, so ist kein Ende in Sicht. Und das Faszinierende in diesem Prozess: die Vitalität ist mit den Jahren gar noch stärker geworden.
Willem Breuker spielt weder für die Linienrichter des Kulturbetriebs noch für die Nachwelt. „Ich“, bekennt er, „spiele Menschenmusik“. Eine Musik, in der Spaß und Ironie, tiefere Bedeutung und Hintersinn wilde Lebensgemeinschaften ohne Trauschein eingehen und die keiner anderen Moral verpflichtet ist, als Klänge und Alltagsleben in ein spannungsreiches Verhältnis zu setzen. Willem Breuker will für die Leute spielen. Und da er deren Bedürfnisse ernst nimmt, baut er Brücken zum Publikum, integriert er Späße und Clownerien, ohne seinen musikalischen Anspruch herunterzuschrauben. Die Verpackung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, was sich in ihr verbirgt: eine gleichermaßen nostalgische und neue, in jedem Falle eine sinnliche Musik voller elementarer Ausruckskraft, Raffinesse und wilder Schönheit.
Breuker kommt aus der holländischen Free-Jazz-Szene, war einer der ersten, die in Europa frei improvisierte Musik gespielt haben. In den 60er-Jahren bildete er gemeinsam mit dem Schlagzeuger Han Bennink und dem Pianisten Misha Mengelberg ein Dreigestirn. Die Troika, die sich 1967 zum Instant Composers Pool (ICP) zusammenschloss, tritt nicht mehr gemeinsam auf. Die Drei gehen eigene Wege, ohne sich gänzlich aus den Augen/Ohren verloren zu haben. Breuker entwickelte eine individuelle Musik, für die er ein kollektives Medium schuf. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er mit dem Willem Breuker Kollektief. Und das musikereigene Plattenlabel BVHAAST begleitet seither diesen Prozess, nicht nur die eigene, sondern viele Arten von Musik, die man nirgendwo anders finden kann, engagiert dokumentierend.
„Wenn man spielt, dann hat man alles vergessen, dann passiert es einfach. Und es hat auch nur Sinn, wenn man es hundertprozentig macht. Halb geht so etwas nicht, dann muss man aufhören.“ Der so spricht kommt vormittags allmählich mit einem starken Kaffe in Gang und wird hellwach, wenn es um Fragen des Kollektiefs geht. In seiner Amsterdamer Wohnung, nahe dem Oosterpark, gibt er Auskunft über das, was er eigentlich gar nicht wissen will. „Ich habe bei uns noch keinen erlebt, der keine Lust hat zu spielen oder mit halber Kraft spielt. Das hat auch mit der Musik zu tun und mit der Mentalität. Warum bleibt man so lange im Kollektief? Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und ich will es auch gar nicht wissen. Man muss einfach mal das machen und weitermachen. Und dann, nach dem Konzert, denkt man: Schade, der Abend ist schon wieder vorbei. Wann ist das nächste Konzert?“ Breuker liebt das Paradox. Er, der die Musik des zwanzigsten Jahrhunderts bis in die Verästelungen kennt, den Jazz ebenso wie die klassische Moderne und die Avantgarde, formuliert gern Sätze wie diesen: „Wir machen etwas, von dem wir alle nicht wissen, was wir tun.“
Willem Breuker ist ein Workoholic. Mit seinem Kollektief beweist er, dass es möglich ist, straffe Organisation und Demokratie, Konzeption und musikalische Freiheit, Alltagsgeschäfte und kreative Höhenflüge unter einen Hut zu bringen. „Ich glaube,“ sagt der Bandleader, der es sich gar nicht leisten könnte, das Leben eines Bohemiens zu führen, weil er sich auch organisatorisch um den Lebensunterhalt der Band kümmern will und muss, „wir beschreiben musikalisch, was es bedeutet, ein Kollektiv zu sein.“
Breuker hält seiner beständig lust- und widerspruchsvoll inszenierten Musik alle Flucht- und Auswege offen. Er streckt seine Fühler in alle Richtungen aus, schafft Eigenes und verwandelt unterschiedlichste Vorlagen durch Bearbeitung in eine unverwechselbare Klangsprache, die des Kollektiefs. Im wilden Wechsel der Takt- und Tonarten wie auch der Stilebenen geht es immer wieder bis an den Rand des Chaos. Wie es die Band schafft, schließlich doch nicht abzustürzen, zählt zur spannungsreichen Spontan- Dramaturgie jedes Live-Konzertes mit dem Kollektief.
Ganz in der Tradition von Brecht/Weill hat sich Breuker stets als „eingreifender“ Musiker begriffen und dabei etwas erfahren, was Kurt Weill einmal so beschrieb: „Wenn die Musik gestisch ist, handeln die, die Musik machen.“ Bei Breuker wird diese Erfahrung aus unterschiedlichen Quellen gespeist: Er begann in jungen Jahren mit aktionistisch orientierten und sozial engagierten Musik-Performances; er gewann – vor allem durch die Mitarbeit als Komponist und Musiker bei Theaterproduktionen – außerordentliche Flexibilität im Umgang mit den szenisch-musikalischen Mitteln und Möglichkeiten; und er steht in der Tradition einer neuen europäischen Improvisationsmusik, die er selbst mit aus der Taufe gehoben und in seine unterschiedlichen Konzeptionen integriert hat.
Blickt Breuker auf die zeitgenössische Neue Musik, befürchtet er zunehmende Blutleere im Gehirn. Begriffe wie Minimal Music, serielle Musik oder Neue Tonalität deuten für ihn auf Dogmen, die er ebenso zu durchbrechen versucht wie die Trennung des konzipierenden vom ausübenden Musiker. „Es gibt Komponisten, die sieben Jahre an einem Stück sitzen und dann glücklich sind, wenn es tatsächlich gespielt wird. Dann brauchen sie wieder fünf Jahre, um etwas neues zu erarbeiten. Meines Erachtens ist das nicht der richtige Weg. Ich bin froh, dass ich einen Modus gefunden habe, der es mir ermöglicht, gleichzeitig zu schreiben, zu spielen und mit dem Kollektief aufzutreten.“ Erweiterungen seines im wesentlichen aus Bläsern bestehenden Klangkörpers durch Streicher-Ensembles inspirieren Breuker, das Spektrum orchestraler Klangfarben auszuschreiten. „Früher, in den zwanziger und dreißiger Jahren“, sagt er, der noch immer stärker in der Tradition der Blas-Kapellen als in der der Sinfonieorchester steht, „war es ganz normal, dass ein Orchester auch Streicher hatte oder Bläser alterierend Violine gespielt haben.“ Was immer er integrieren kann, Breuker nutzt es, um Brücken zu schlagen zwischen Nostalgie und Innovation. Die Haltung ist für ihn wichtiger als das Material. Ob Marsch oder Tango, klassische Komposition, Jazzstandard oder freie Improvisation – ihm geht es darum, die Kontexte aufzubrechen.
Seine Partituren sind durchsetzt mit Spielanweisungen, die sich nicht allein über die Interpretation des Notentextes, sondern letztlich nur über die Art der Darbietung realisieren lassen: Ironie und Travestie, Persiflage und Parodie. Kulinarisches Schwelgen gerät plötzlich zum kritischen Biss und umgekehrt. Aufgeblasenes Pathos wird angepiekst, Luft abgelassen. Was uns schließlich entgegenbläst, kann Spaß machen, und es kann wach machen. Weder mit jubelnden Fanfaren noch mit donnernden Trugschlüssen will uns das Willem Breuker Kollektief etwas vorgaukeln. Es entlässt uns nicht in die Illusion, sondern in die – von Widersprüchen durchzogene – Wirklichkeit.
Er wolle, hat Breuker einmal bekannt, das Publikum nicht nur zum Lachen bringen, sondern ihm auch einen Lachspiegel vorhalten. In der szenischen Präsentation – weit weniger übrigens im Musikalischen – gerät manches zum plumpen Spaß, zum Klamauk. Hat er das nötig? „Ja, das ist auch gewollt. Ich will ab und zu auch den guten Geschmack in Frage stellen. Manches passiert noch immer völlig unerwartet, und dann ist es am besten.“ Ging es früher um Provokation, so setzt der Bandleader heute eher auf gelegentliche (Selbst-)Irritation.
Breuker liebt das Changieren zwischen Arie und Gassenhauer, Orchestersuite und Dreigroschenmusik. Zu seinem Lieblingskomponisten zählen Duke Ellington und Ennio Moricone, Kurt Weill und George Gershwin, seine Wahlverwandten. Neben der Arbeit mit dem Kollektief gibt es ein reichhaltiges Menü: Kompositionen für Film und Theater, für Drehorgeln und alle nur denkbaren Besetzungen. Vor einigen Jahren entstand ein groß angelegtes Oratorium: „Psalm 122“. Das religiöse Thema verwandelt Breuker in ein allgemein berührendes: „Es geht um Jerusalem, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um miteinander zu leben – ohne oder mit Religion. Sie sprechen über Gott, aber meinen ihnen vielleicht gar nicht, sondern gebrauchen nur seinen Namen.“ Ein ungewöhnliches Werk, ein ganz anderer Breuker. „Nach der ersten Reihe von Konzerten gab es eine gemeinsame Mahlzeit, eine alttestamentarische Geste: Leuten leben miteinander, arbeiten miteinander und essen miteinander, und es gibt Frieden. Das klingt vielleicht ein bisschen naiv. Es war für viele sehr bewegend.“
Mit freundlicher Genehmigung von Triangel